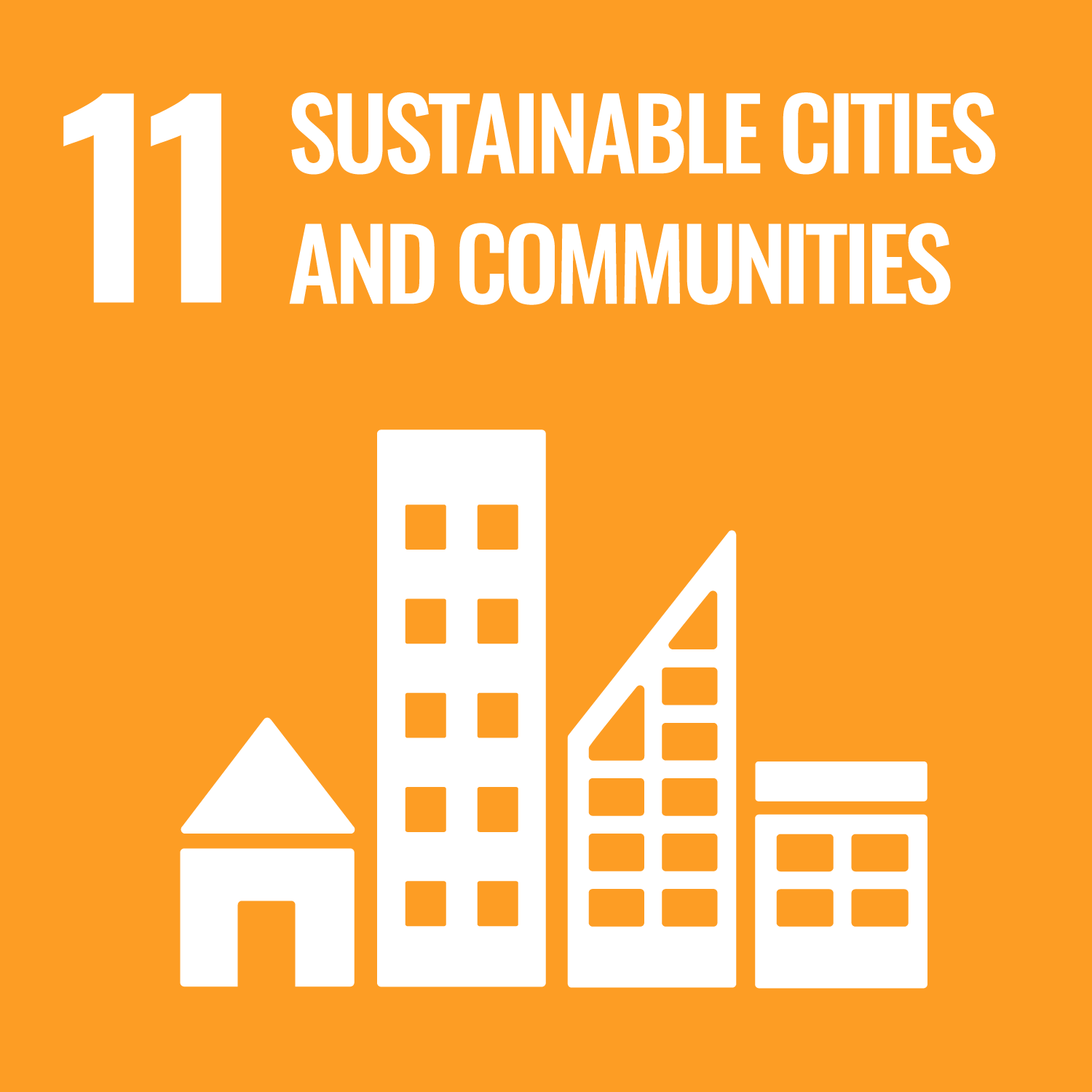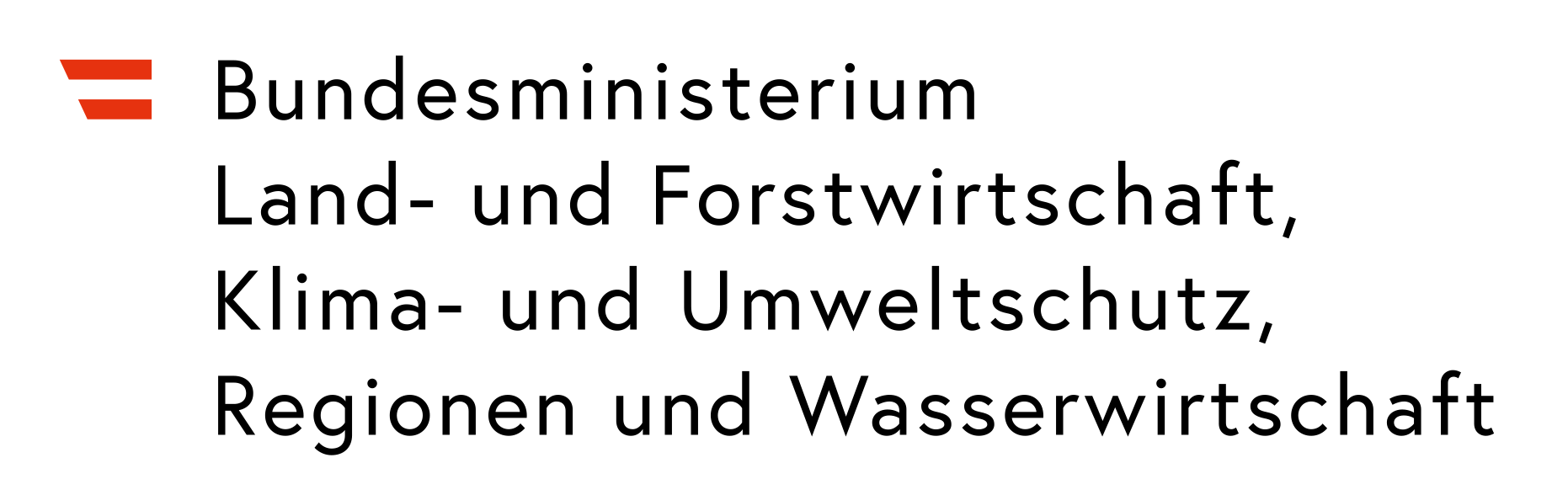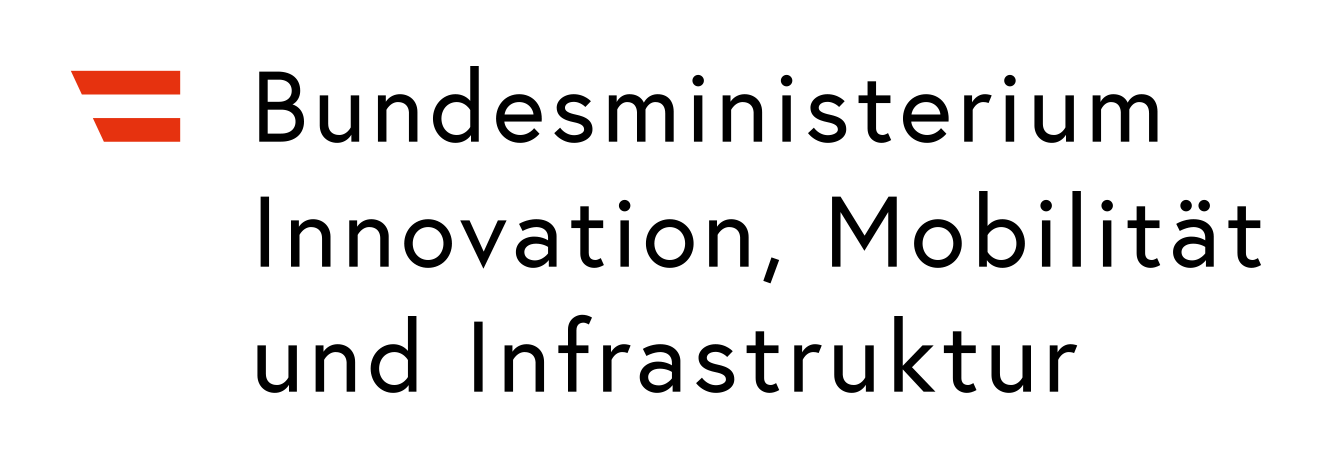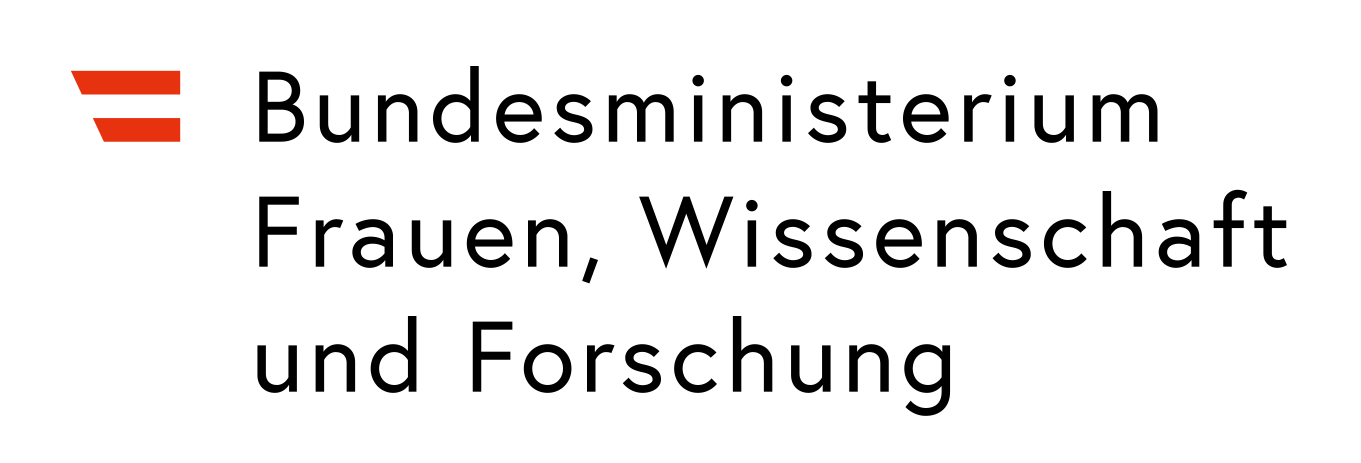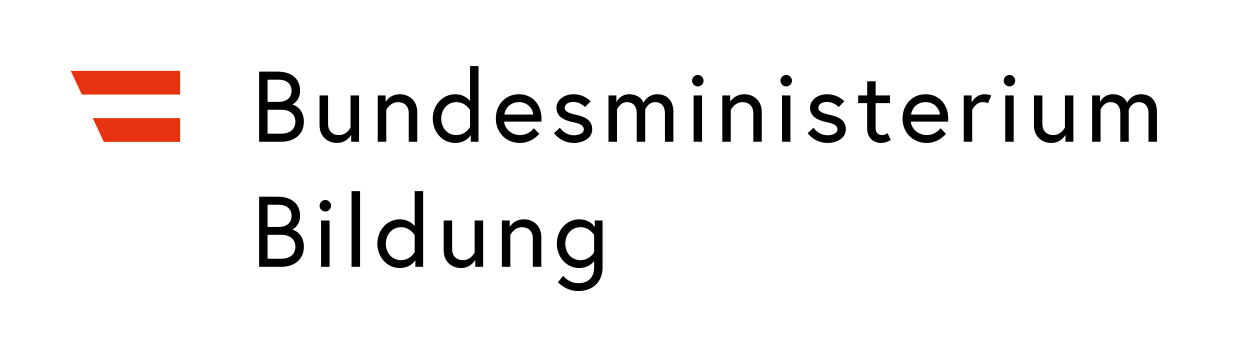Maßnahmen
Siedlungsentwicklung auf bereits in Anspruch genommenen Flächen
Siedlungsentwicklung soll insbesondere zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen ohne weitere Flächeninanspruchnahme stattfinden. Die Aufwertung von Leerstandsflächen ist in Ortskernverdichtungskonzepten strategisch zu planen und durch Förderung der Sanierung bzw. des Abrisses und des ressourcenschonenden Neubauens umzusetzen. Der Vorrang der Bebauung von bereits in Anspruch genommenen oder versiegelten Flächen soll durch die Raumordnungsgesetze der Bundesländer sowie durch die Instrumente der überörtlichen Raumordnung forciert werden. Der Bund wirkt bei der Umsetzung der ÖROK-Empfehlungen zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne und zum Flächensparen, Flächenmanagement und zur aktiven Bodenpolitik unter Beachtung der aktuellen Gefahren- und Risikolage aufgrund von Naturgefahren unterstützend mit.
Federführend: BML
Mitwirkende: Länder, Gemeinden
Umsetzung: ÖROK, Ordnungsrecht der Länder und Gemeinden, GSP 23-27, Regionen-Dialog Plattform, Bildungsmaterialien zum Bodenschutz, Fachgutachten/Studien
Status: in Umsetzung
Sustainable Development Goal (SDG):
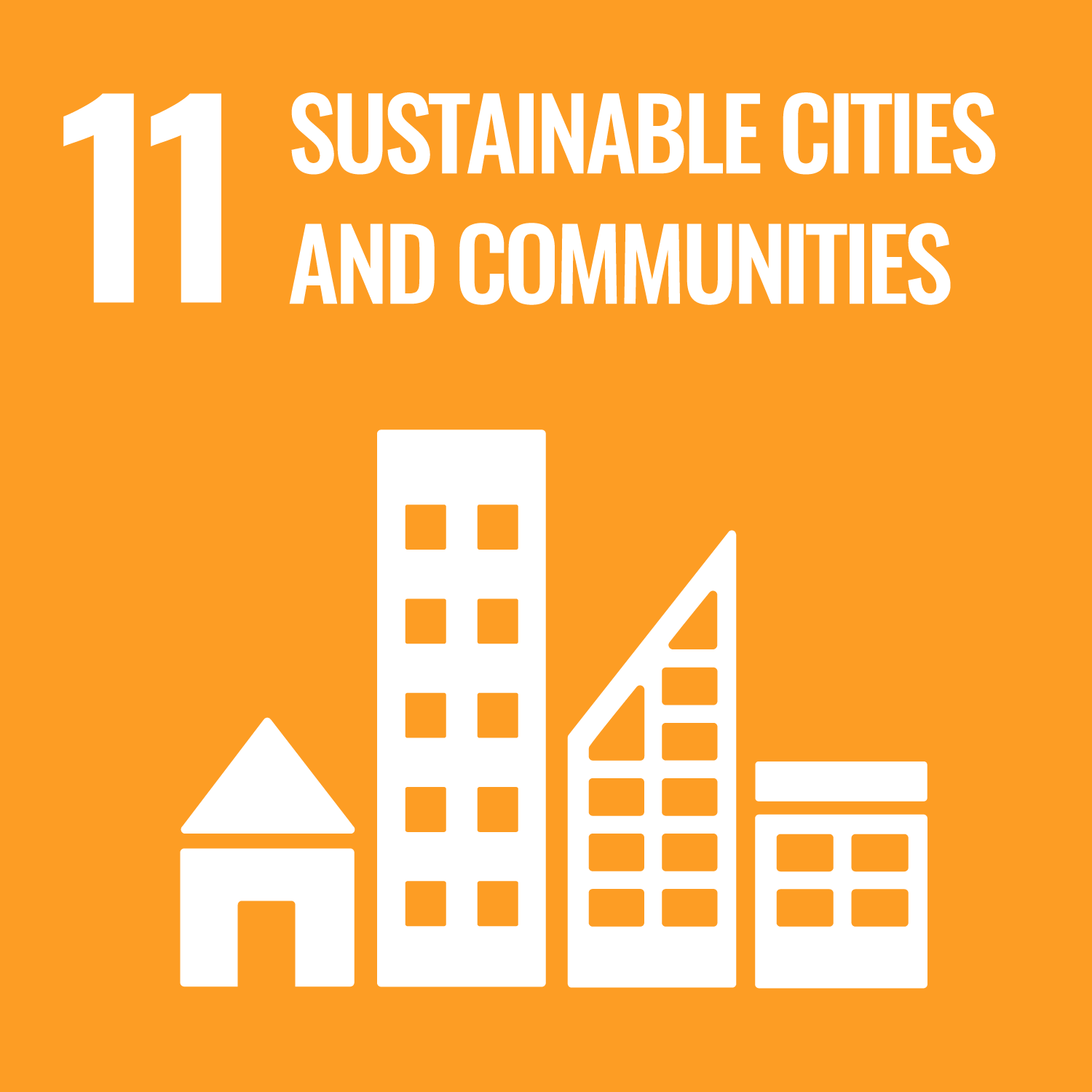
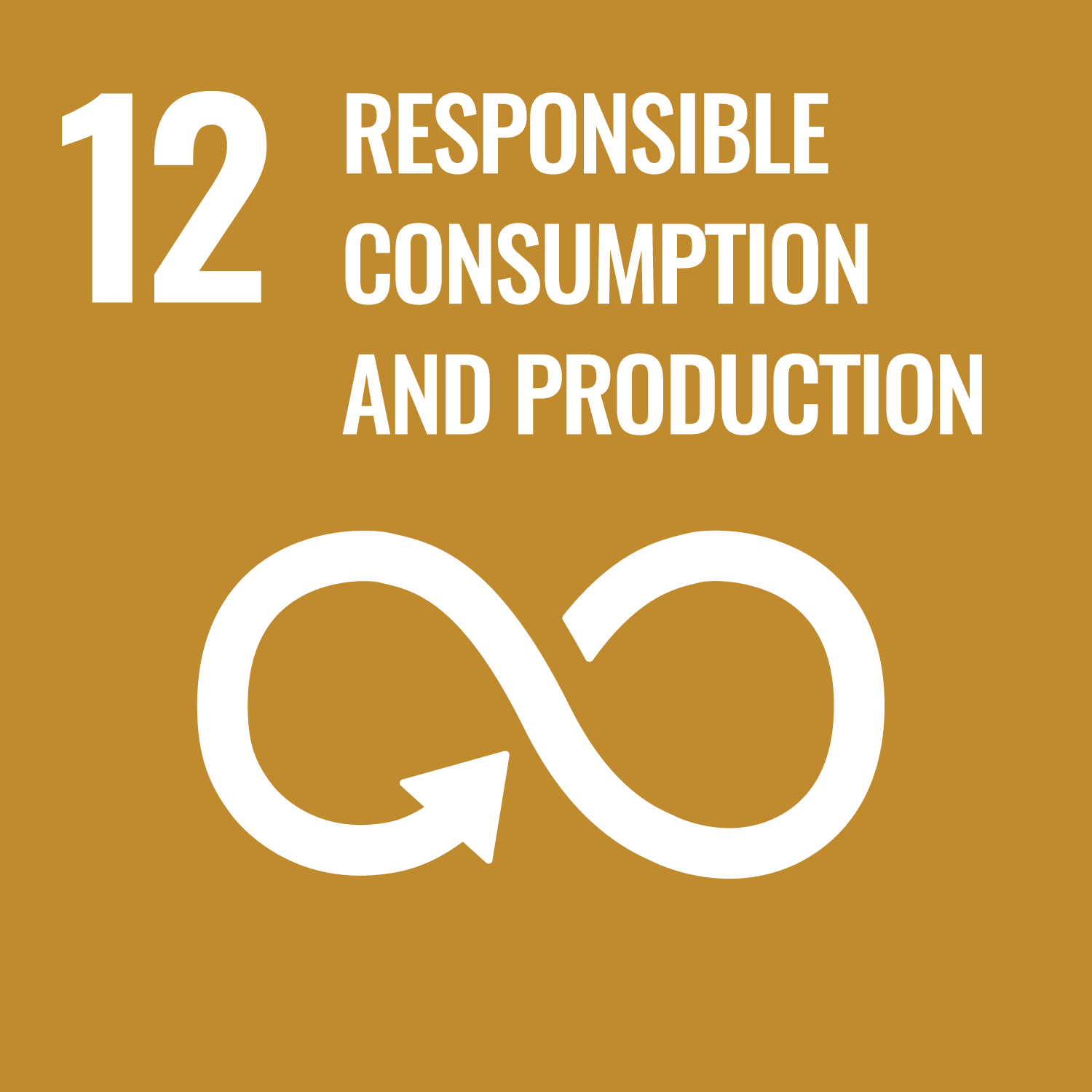

Anreize zur Revitalisierung von Orts- und Stadtkernen
Das Aussterben vieler Ortskerne geht einher mit einem Neubau von Versorgungsstrukturen und Wohngebieten an den Ortsrändern. Für diese werden zunehmend wertvolle Agrarflächen umgewidmet und gehen der Produktion verloren. Um diesem Trend zu entgegnen, werden bewusstseinsbildende Maßnahmen und Beratungsangebote und Entwicklungskonzepte unterstützt. Zusätzlich gilt es, Förderungen zur Sanierung, Modernisierung und Ausbau von leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden einzurichten. Diese Maßnahme ist auch eine Maßnahme der ÖROK Empfehlung Nr. 58: „Raum für Baukultur“.
Federführend: BMK, BML
Mitwirkende: Länder, Gemeindebund, Städtebund
Umsetzung: Altlastensanierung sowie ARP - Flächenreycling, GSP 23-27, ÖROK
Status: in Umsetzung
Sustainable Development Goal (SDG):
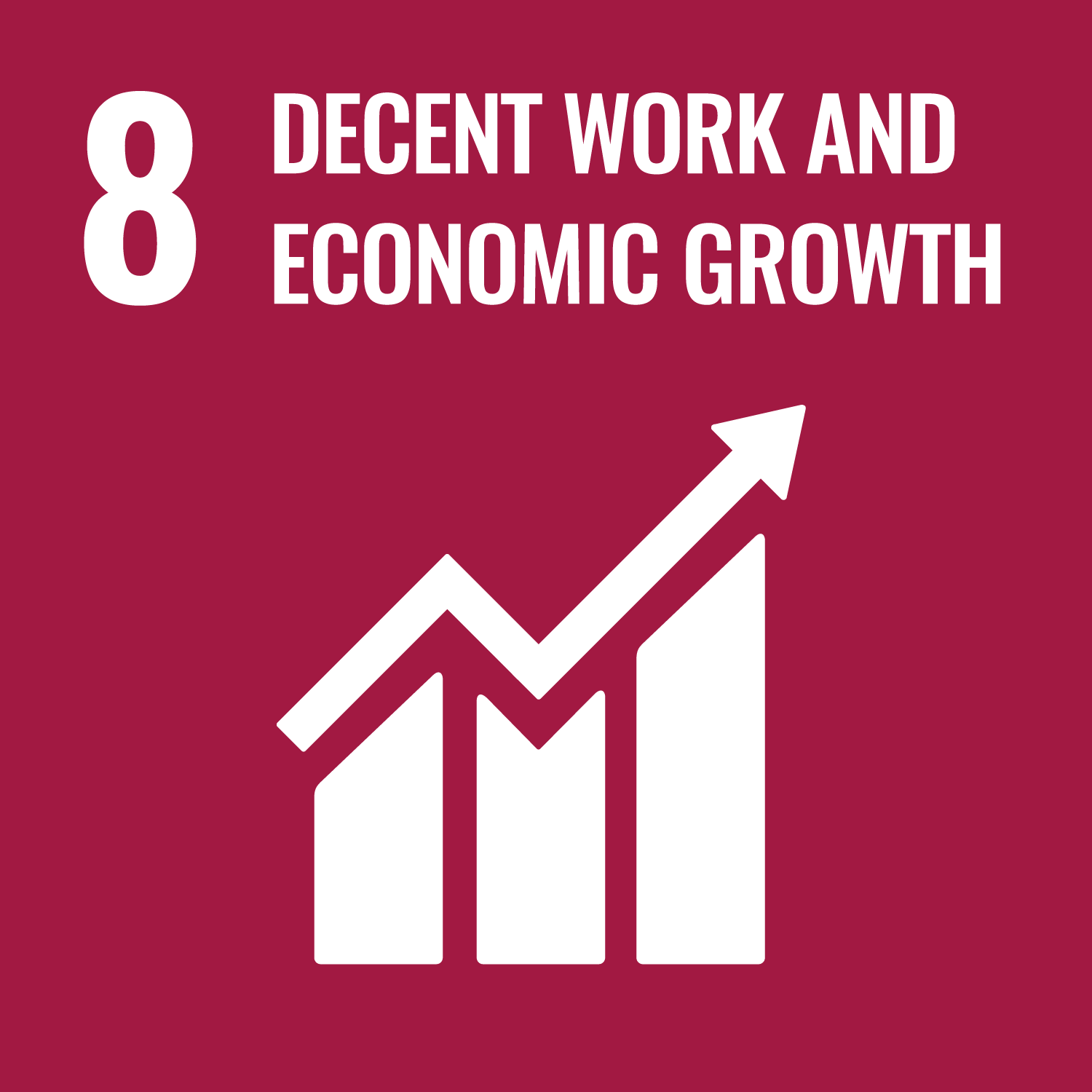
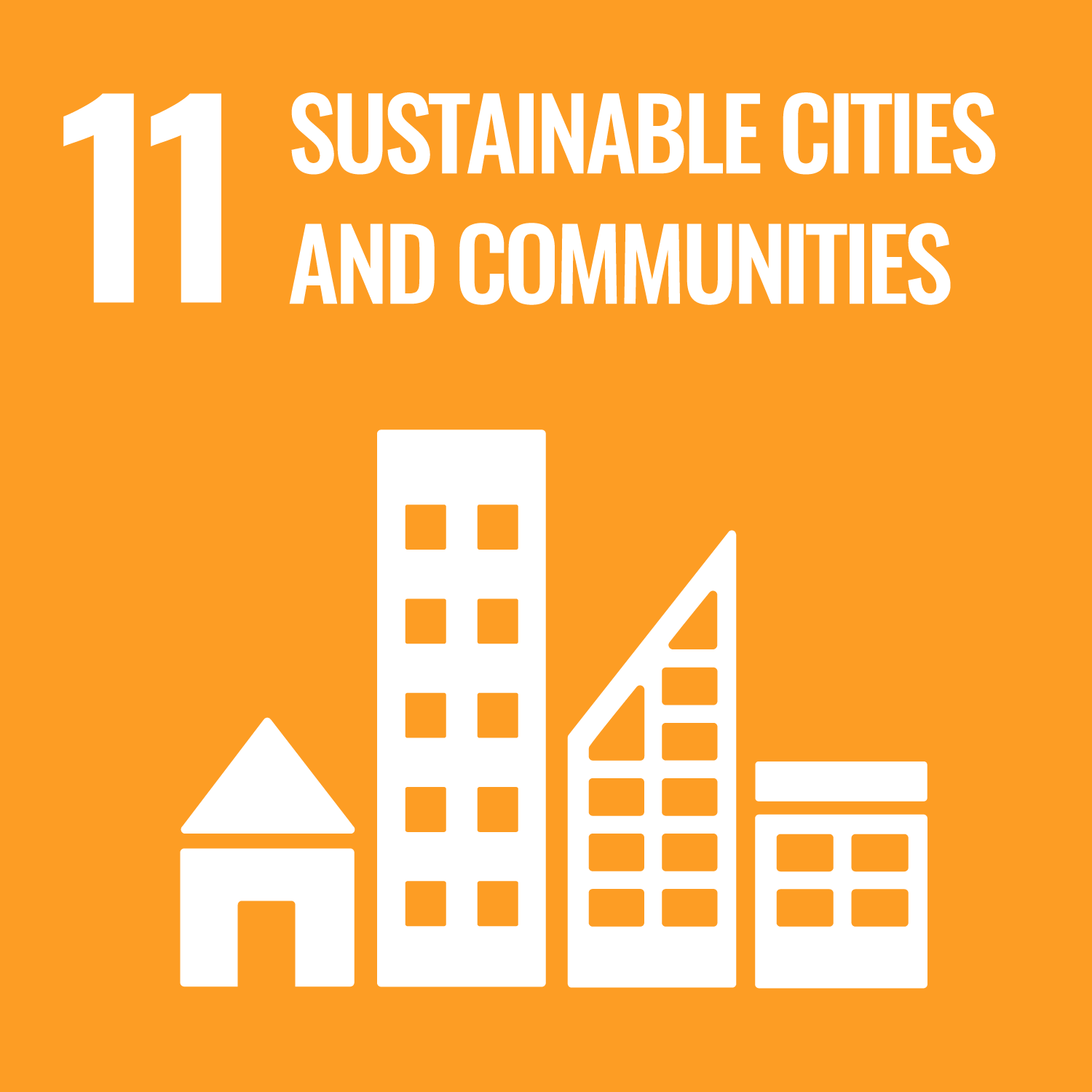

Forschung zu klimaintelligenten Städten und Gemeinden
Auch bei einer drastischen Reduktion des Flächenverbrauchs werden zukünftig weiterhin landwirtschaftlich nutzbare Flächen durch Baumaßnahmen verbraucht werden. Daher sind auch Ausgleichsmaßnahmen zur Reduktion der negativen Effekte erforderlich. Stadtbegrünung ist eine der günstigsten und nachhaltigsten Lösungen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. Die Integration von Urban- und Vertical Farming in derartige Konzepte wäre daher schlüssig. Die Grundlagen für diese Konzepte müssen jedoch erst entwickelt werden. Forschungsfragen zur Stadtbegrünung ergeben sich in der Baustatik und der Reststoffverwertung. Neben der Forschung ist auch die Beratung und Information von Bauträger:innen, Baumeister:innen, Architekt:innen sowie möglicher Betreiber:innen erforderlich. In einem ersten Schritt sind im Zuge von Reallaboren Bedarfe zu identifizieren. Die Beratung und Erstellung von Anpassungskonzepten erfolgt im Rahmen der Klimawandelanpassungsregionen KLAR des Klimafonds.
Federführend: BMK
Mitwirkende: Länder, Gemeinden, FFG
Umsetzung: Reallabore, FTI-Initiative Technologie und Innovation für die klimaneutrale Stadt (TIKS)
Status: begonnen, mittelfristig in Planung
Sustainable Development Goal (SDG):

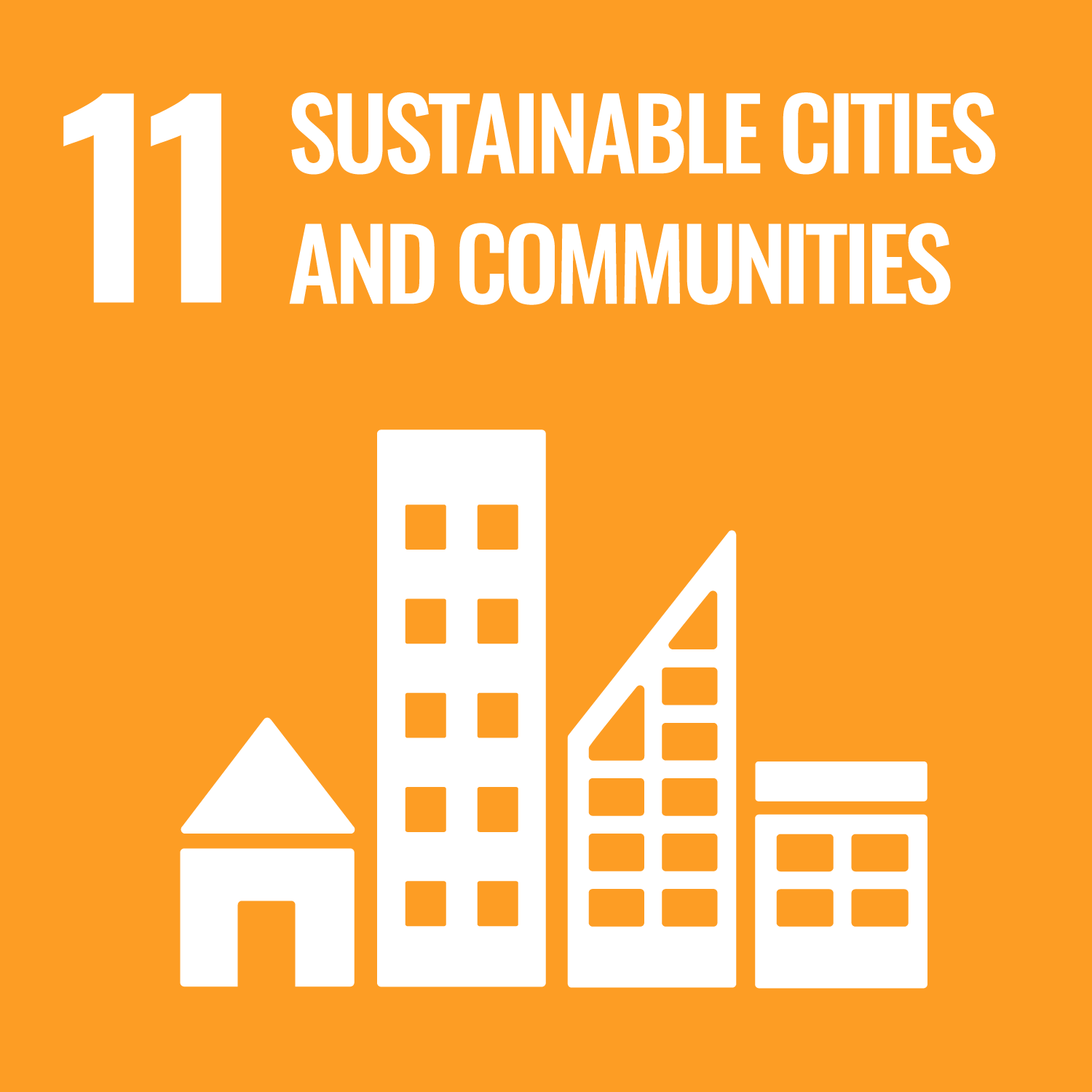
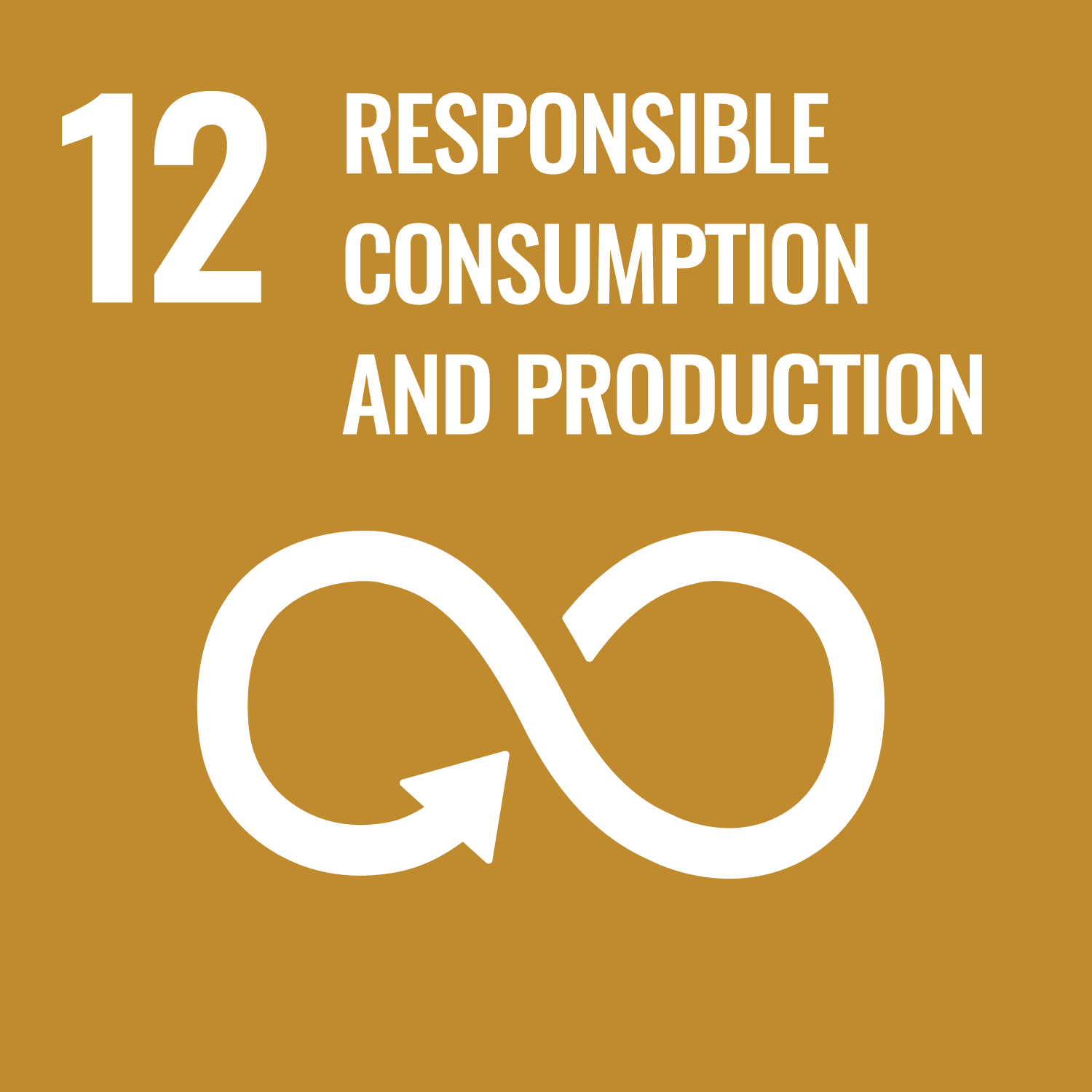
Kombination PV und Landwirtschaft
Um möglichst viele produktive Flächen für die Landwirtschaft, aber auch für Biodiversität, Naturschutz und Erholungszwecke frei zu halten, soll der PV-Ausbau prioritär auf bereits versiegelten Flächen wie Dach-, Park-, Deponieflächen oder Altlasten erfolgen. Durch die Umsetzung von Agri-PV-Anlagen kann eine landwirtschaftliche Fläche sowohl für die Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen als auch für die Erzeugung von erneuerbarer Energie genutzt werden. Diese sinnvolle Doppelnutzung kann somit den Flächenverbrauch reduzieren, die Einnahmequellen der Landwirte diversifizieren und der Flächenkonkurrenz entgegenwirken. Konzepte, bei denen Agri-PV-Anlagen als Schattenspender für geeignete Kulturen oder Schutzeinrichtungen vor Hagel, Starkregen oder Frost dienen und die Resilienz gegen die Folgen des Klimawandels erhöhen, werden bereits ausgearbeitet bzw. in internationalen und nationalen Forschungsprojekten untersucht. Hier wird für die kommenden Jahre noch weiterer Forschungsbedarf gesehen. Im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, beziehungsweise in den darauf aufbauenden Verordnungen wurden bereits umfassende Fördermöglichkeiten für Agri-PV-Anlagen im Sinne einer nachhaltigen und sinnvollen Flächennutzung gesetzt. Diese sind, im Gegensatz zu herkömmlichen PV-Freiflächenanlagen, nicht vom 25%-igen Förderabschlag betroffen und erhalten sogar einen Förderzuschlag von 30%, wenn es sich um eine innovative Agri-PV-Anlage handelt. Als solche gelten Agri-PV-Anlagen mit vertikal montierten Modulen oder aufgeständerten Modulen mit einer Höhe von mindestens zwei Metern.
Federführend: BMK
Mitwirkende: Länder, BML
Umsetzung: VO EAG Investitionsförderung – Strom, EAG-Marktprämienverordnung
Status: in Umsetzung
Sustainable Development Goal (SDG):
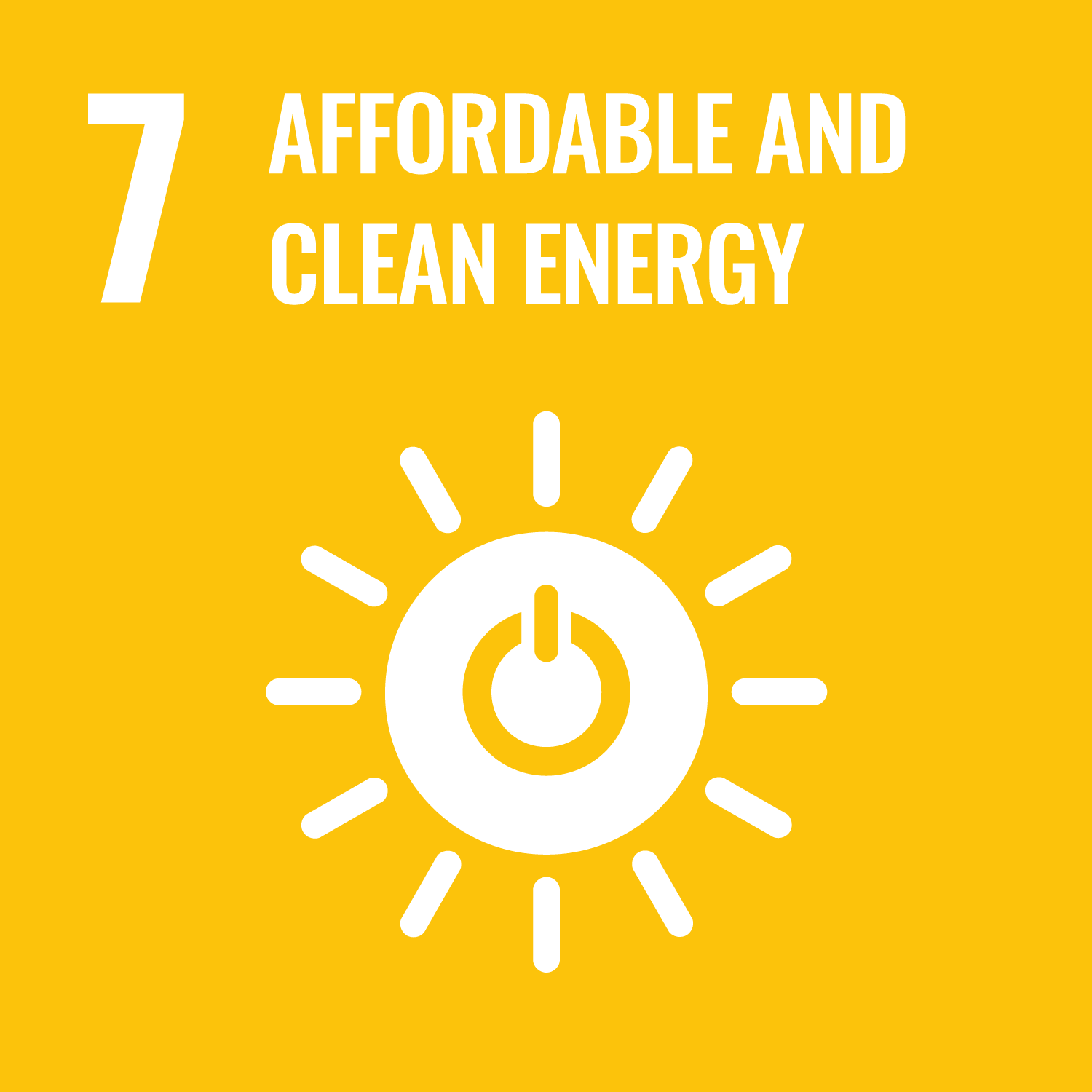
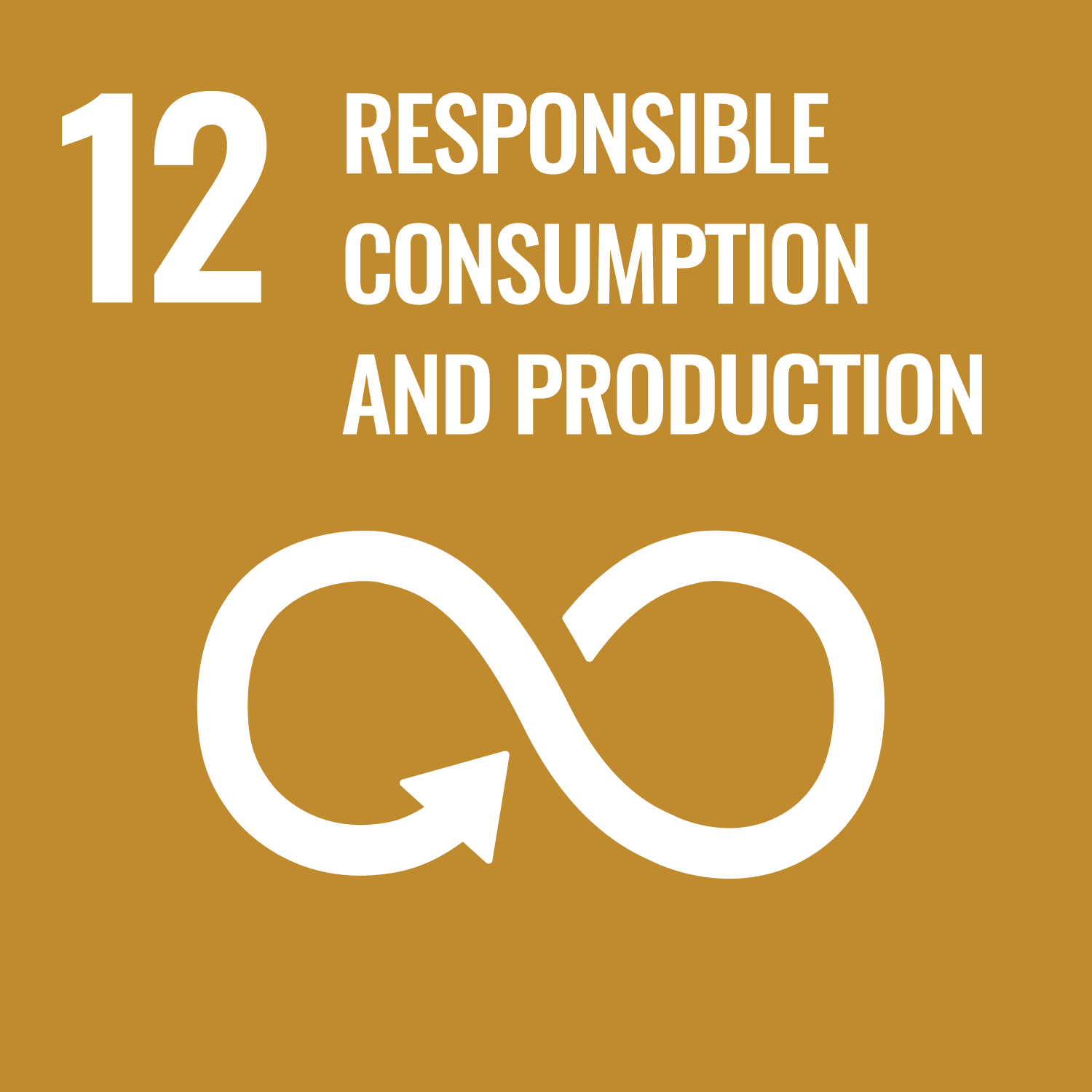
Nachnutzung von Gewerbe- und Industriebrachen
Die Flächeninanspruchnahme in Österreich liegt aktuell bei täglich circa 12 Hektar pro Tag und muss jedenfalls reduziert werden. Die Nachnutzung von Gewerbe- und Industriebrachen entlastet den Siedlungsdruck und reduziert den Verbrauch wertvollen Agrarlandes. Von Seiten des BMK werden mehrere Initiativen gesetzt. Einerseits bildet der Brachflächen-Dialog eine Plattform für den Wissensaustausch und Best-Practice Beispiele. Andererseits wurde die Umweltförderungsschiene Flächenrecycling geschaffen. Ziel ist die Unterstützung von Projekten zur Entwicklung und Wiedernutzung von nicht mehr oder nicht entsprechend dem Standortpotenzial genutzten Flächen und Objekten in Ortskernen. Es gibt aber auch Gewerbe- und Industriebrachen, welche sich keiner wirtschaftlichen Nachnutzung mehr eignen. Bei fachgerechten und effizienten Rückbau (Stichwort: Urban Mining) können diese Plätze auch wichtige ökologische Trittsteine oder zusätzliche Biotope darstellen.
Federführend: BMK
Mitwirkende: Länder, Gemeinden, Unternehmen
Umsetzung: UFG, ÖARP, NextGenerationEU
Status: begonnen, langfristig in Planung
Sustainable Development Goal (SDG):

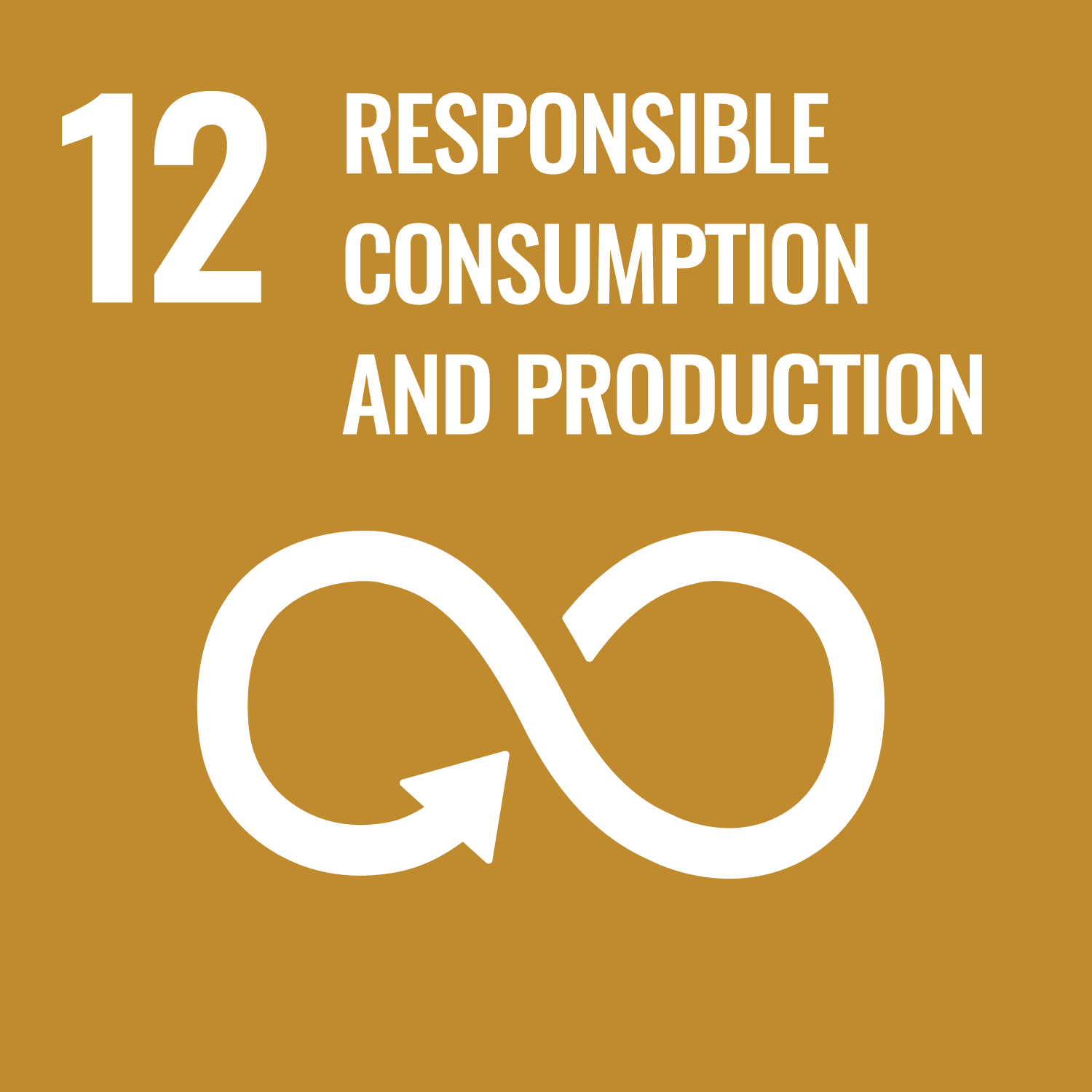


Renaturierung von gefährdeten Ökosystemen
Mit dem Biodiversitätsfonds legt das österreichische Klimaschutzministerium eine Förderungsschiene, die wesentlich zur Erreichung der österreichischen Biodiversitäts-Ziele beiträgt. Darüber hinaus versteht sich der mit 80 Millionen Euro dotierte Biodiversitätsfonds auch als Ergänzung zu den Maßnahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union und des Waldfonds. In eigenen Ausschreibungen werden Projekte zur Wiederherstellung und zum Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume unterstützt.
Federführend: BMK
Mitwirkende: BML, Naturschutzbehörden der Bundesländer, Unternehmen, Lokale-Partner
Umsetzung: Biodiversitätsfonds, nicht produktive Investitionen im Rahmen des GSP 23-27, Waldfonds
Status: in Umsetzung, kurz-, mittel-, langfristig in Planung
Sustainable Development Goal (SDG):